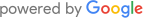10.11.2025
Steueramt Zürich und Datenschutz: Wie weit darf die Datenerhebung im Steuerverfahren gehen?
Die Praxis des Kanton Zürich, bei Wohnsitzprüfungen umfangreiche Standort- und Kommunikationsdaten anzufordern, wirft Fragen zur Verhältnismässigkeit auf.
Im Rahmen sogenannter Wohnsitzprüfungen verlangen kantonale Steuerämter zunehmend detaillierte Nachweise über den tatsächlichen Lebensmittelpunkt einer Person. Auch im Kanton Zürich sollen laut Medienberichten teilweise Standortdaten, Telefonlisten und andere persönliche Bewegungsinformationen eingefordert worden sein, um die Steuerpflicht festzustellen.
Solche Verfahren berühren den sensiblen Bereich zwischen Steuertransparenz und Datenschutz. Zwar erlaubt das Steuerrecht den Behörden, Belege zur Klärung des Steuerdomizils einzufordern, doch jede Datenerhebung unterliegt dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit: Nur was geeignet, erforderlich und zumutbar ist, darf verlangt werden.
Die Pflicht zur Mitwirkung darf nicht zu einer faktischen Umkehr der Beweislast führen. Bürger müssen ihre Steuerpflicht belegen, nicht ihre Unschuld beweisen. Standortdaten oder Kommunikationsverläufe über mehrere Jahre sind nur in Ausnahmefällen zulässig und müssen im konkreten Zusammenhang begründet werden.
Juristisch problematisch wird es, wenn die Behörden auf Routinen zurückgreifen, statt individuelle Abwägungen vorzunehmen. Das kann – neben datenschutzrechtlichen Risiken – auch das Vertrauen internationaler Steuerzahler in den Wirtschaftsstandort Zürich schwächen.
Empfehlenswert ist, bei jeder Datenanforderung des Steueramts Zürich die Rechtsgrundlage zu prüfen, irrelevante Passagen zu schwärzen und die Verhältnismässigkeit schriftlich anzusprechen. Nur so bleibt das Verfahren rechtsstaatlich kontrollierbar.
#SteueramtZürich #Datenschutz #Steuerrecht #Wohnsitzprüfung #Standortdaten #Privatsphäre #Rechtsstaat #Zugtrust #LegalInsight
© 2025 Ludwig Limbeck AG, Zug, Autor Rolf Limbeck