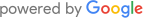Der Bundeshaushalt 2025 zeigt steigende Sozialausgaben und stagnierende Einnahmen – doch einzelne Kantone setzen weiterhin auf gezielte Steuersenkungen.
Der Schweizer Bundeshaushalt 2025 verdeutlicht eine wachsende Haushaltsasymmetrie: Auf der Ausgabenseite steigen die Kosten für Gesundheit, Sozialtransfers und Energiekompensation deutlich; auf der Einnahmenseite stagniert das Steueraufkommen. Die Schuldenbremse bleibt formell eingehalten, doch die strukturellen Überschüsse der vergangenen Jahre schmelzen.
In dieser angespannten Lage reagieren die Kantone unterschiedlich. Genf, Waadt und Neuenburg haben 2025 spürbare Steuersenkungen beschlossen, insbesondere bei den oberen Progressionsstufen der Einkommenssteuer. Die Reduktionen liegen zwischen 0.5 und 1.5 Prozentpunkten und sollen den Exodus von Spitzenverdienern und Unternehmern in steuergünstigere Regionen bremsen.
Parallel prüfen auch andere Kantone – darunter Zug, Schwyz und Nidwalden – moderate Anpassungen, um ihre Standortattraktivität im europäischen Umfeld zu sichern. Für natürliche Personen und Expats ergeben sich daraus neue Gestaltungsspielräume bei der Wohnsitzwahl und bei Quellensteuersituationen.
Doch die Entlastung auf Kantonsebene kollidiert mit der finanziellen Realität des Bundes. Steigende Sozialkosten und stagnierende Unternehmensgewinne führen dazu, dass die Steuerbasis zwar stabil, aber nicht mehr wachsend ist. Das Verhältnis zwischen Solidarität und Standortförderung gerät dadurch in ein sensibles Gleichgewicht.
Rechtlich stellt sich zunehmend die Frage, ob der kantonale Steuerwettbewerb noch im Sinne der Steuerharmonisierungsgesetze operiert – oder ob langfristig eine Neujustierung der Finanzausgleichsmechanismen erforderlich wird. Bereits heute warnt die Eidgenössische Finanzverwaltung vor wachsenden Disparitäten zwischen ressourcenstarken und strukturschwachen Kantonen.
Für Mandanten hat diese Entwicklung unmittelbare Konsequenzen:
-
Privatpersonen sollten ihre Steuerdomizile aktiv überprüfen, insbesondere bei Immobilienbesitz oder Teilselbstständigkeit in unterschiedlichen Kantonen.
-
Unternehmen profitieren zwar kurzfristig von niedrigeren kantonalen Sätzen, müssen aber langfristig mit indirekten Belastungsverschiebungen rechnen – etwa über Abgaben, Gebühren oder eingeschränkte Förderprogramme.
Die Schweiz bleibt fiskalisch stabil, doch der Trend zeigt: Die Ära des komfortablen Gleichgewichts zwischen Überschuss, Standortvorteil und sozialem Ausgleich geht zu Ende. Der Wettbewerb um Steuerzahler nimmt zu – und mit ihm das Risiko einer fiskalischen Erosion im Innern.
(c) Ludwig Limbeck AG, Autor Rolf Limbeck